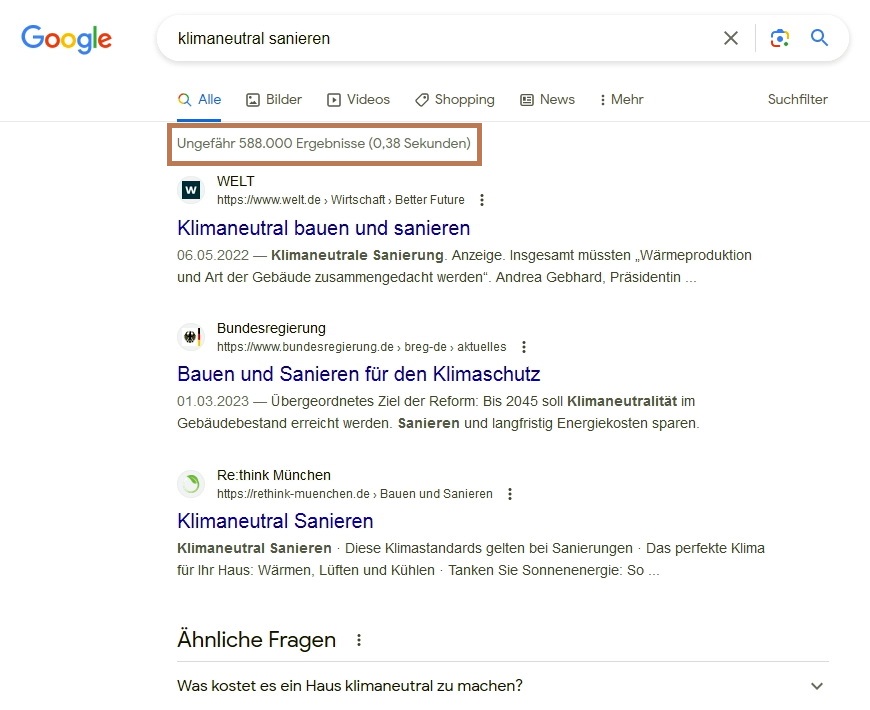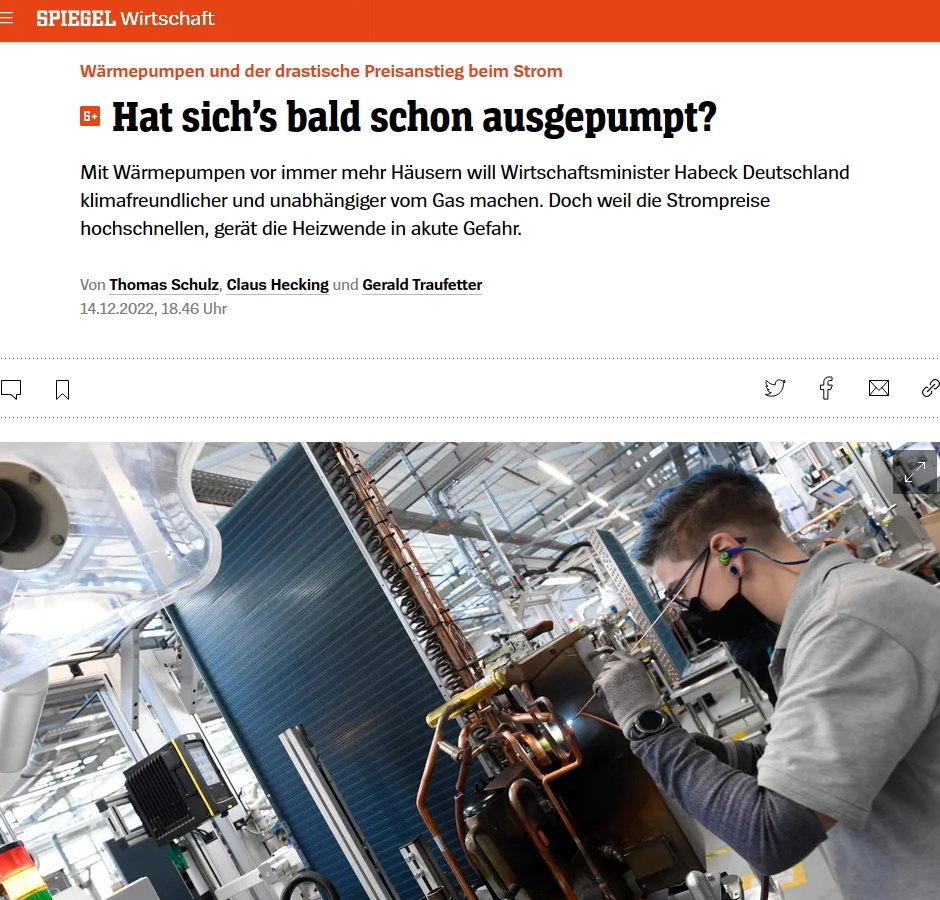Die Energiesparpyramide. Besser klimaneutral sanieren.
Zukunftssicher sanieren – wie kann das heutzutage gelingen?
Das Ziel ist klipp und klar gesetzt: Unsere Häuser sollen bis 2045 klimaneutral werden. Fossile Heizkessel sollen bis dahin durch Heizungen ersetzt werden, die mit erneuerbaren Energien laufen.
Unklar, ungewiss und unsicher ist derzeit aber Vieles, was die praktische Umsetzung dieser Wärmewende betrifft.
Unklar etwa ist, welche klimaneutrale Heizungstechnik künftig die Nase vorn hat. Ist es hauptsächlich die Wärmepumpe? Oder sind Heizungen auf der Basis von Geothermie, Solarenergie, Wasserstoff, Biogas, E-Fuels und Holzbrennstoffen mit von der Partie?
Ungewiss etwa ist, ob das Haus in Zukunft einen Fernwärmeanschluss erhält. Das soll sich zwar bis 2028 durch kommunale Wärmepläne überall entscheiden, aber befreit die Aussicht auf Fernwärme Hausbesitzer’*innen von jeglicher Ungewissheit? Nicht ganz, denn klimaneutrale Fernwärme könnte teuer werden, bedenkt man die Milliardensummen, die neue Leitungsnetze und fossilfreie Wärmekraftwerke kosten.
Unsicher sind vor allem die künftigen Energiepreise. Wird es, wie schon oft in der Vergangenheit, in den nächsten Jahren erneut überraschende Energiepreissprünge geben? Und zwar nicht nur bei Erdöl und Erdgas, sondern generell wie zuletzt im Jahr 2022.
Von hohen Heizkosten sind Bewohner*innen energetisch veralteter Gebäude schon heute stark betroffen. Abhilfe verspricht energetisches Sanieren.
Aber wie könnte ein zukunftssicherer Gesamtplan fürs Sanieren aussehen, der die momentanen Unwägbarkeiten in Sachen Energie einkalkuliert? Der auch ein schrittweises Sanieren über viele Jahre hinweg erlaubt – ohne Risiko von Fehlinvestitionen?
Antwort darauf gibt die Energiesparpyramide. Sie liefert eine zukunftssichere Strategie und ein kluges Leitbild für Sanierungen mit dem Ziel der Klimaneutralität.
Oberste Prioriät bei der Energiesparpyramide hat die thermische Sanierung der Gebäudehülle. Thermisches Sanieren bedeutet, die Wärmedämmung von Dach, Außenwänden, Fenstern und Keller in einem Rutsch oder mehreren Schritten zu ertüchtigen, am besten auf Neubaustandard. Thermisches Sanieren ist wegen der damit verbundenen Energieeinsparung zukunftssicher – aber noch viel mehr.
Der Vorrang des Energiesparens basiert auf folgendem Grundsatz: Je geringer der Energieverbrauch eines Gebäudes ist, desto leichter fällt es, die noch benötigte Energie aus erneuerbaren Energiequellen zu decken.
Das liegt daran, dass erneuerbare Energien nicht jeden Tag ausreichend zu Verfügung stehen. Und auch an der Jahreszeit, weil im Sommer die meiste Solarenergie anfällt, die meiste Heizenergie aber im Winter benötigt wird.
Die Maxime des geringen Verbrauchs ist keineswegs neu, sondern Fachleuten seit langem bekannt. Ein zusätzliches Argument dafür liefern Wärmepumpen.
Weil jedes heute gebaute Haus rundum gut gedämmt ist, benötigt es nur einen Bruchteil der Heizenergie eines schlecht gedämmten Altbaus. Wegen dieses geringen Energiebedarfs glänzen Wärmepumpen in Neubauten mit einem Höchstmaß an Energieeffizienz – und verursachen so auch bei steigenden Strompreisen relativ geringe Heizkosten.
Und weil Strom bis 2045 vollständig aus erneuerbaren Energien stammen soll, wird ein Haus mit Wärmepumpe nach und nach ganz von selbst klimaneutral.
Warum ist Energiesparen auch für die Energiewende wichtig?
Die Energiewende hat das „große Ganze“, sprich die gesamte Energieversorgung unseres Landes, im Blick. Eine Reihe von Hürden für die Energiewende werden umso niedriger, je stärker man die Energiesparpotenziale im Gebäudebestand ausschöpft.
Eine Hürde sind begrenzte Energieressourcen: Manche klimafreundliche Heizenergien sind heute schon rar – wie zum Beispiel Biogas und Holzbrennstoffe. Vergangenen Winter waren Pellets und Scheitholz in vielen Regionen zeitweise ausverkauft. Bei Biogas entzöge deren Ausbau der Landwirtschaft Ackerflächen, die derzeit dem Anbau von Nahrungsmitteln dienen.
Heizen mit Holzbrennstoffen oder Biogas kann daher in Zukunft nur für einen kleinen Teil der Bestandsgebäude die Lösung sein. Aber selbst in diesen Fällen nützt Energiesparen: Je weniger Brennstoff benötigt wird, desto mehr Gebäude können mit Holz oder Biogas versorgt werden.
Ökostrom aus Sonne und Wind hingegen kann Heizöl und Erdgas künftig vollständig ersetzen. Der dazu notwendige Ausbau der Fotovoltaik und Windkraft schreitet seit einiger Zeit zügig voran.
Der Stromverbrauch wird sich in den nächsten Jahren unter anderem durch immer mehr Wärmepumpen stetig erhöhen. Je stärker der Anstieg des Strombedarfs von Gebäuden durch Energiesparen gedämpft wird, desto früher gelingt der für den Klimaschutz wichtige Kohleausstieg.
Weiterhin schwankt die Stromerzeugung aus Sonne und Wind im Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresverlauf. Benötigt werden deshalb Megawatt-Stromspeicher und Wasserstoff-Reservekraftwerke, besonders bei Dunkelflauten im Winter. Ein solches Puffersystem wird viele Milliarden Euro kosten und den Ökostrom verteuern.
Umgekehrt vermindert eingesparter Strom die Zusatzkosten einer ganzjährig sicheren Stromversorgung aus Sonne und Wind.
Und an noch einer Stelle in der Stromversorgung sind Investitionen nötig: Weil Wärmepumpen an kalten Wintertagen am meisten Strom verbrauchen, muss das Stromnetz vieler Kommunen ertüchtigt werden. Je geringer künftig die Spitzenlasten in den feinen Verästelungen des Versorgungsnetzes sind, desto weniger zusätzliche Stromleitungen werden gebraucht.
Es sind also nicht nur die Hauseigentümer*innen, für die es vorteilhaft ist, beim Sanieren dem Energiesparen oberste Priorität einzuräumen. Den Energieverbrauch zu reduzieren hilft auch, schneller den Ausstieg aus den fossilen Energien umzusetzen.
Exkurs: Wie wird Autofahren klimaneutral?
Klimaneutralität und klassische Verbrennerautos passen nicht zusammen. Die Europäische Union hat deshalb vor einiger Zeit das Ende von Autos mit Benzin- oder Dieselmotor beschlossen. Der Verkauf solcher Neuwagen wird in den Mitgliedsländern der EU ab 2035 nicht mehr erlaubt sein.
Statt Verbrennerautos dürfen dann nur noch klimafreundliche Wagen angeboten werden. Nach dem heutigen Stand der Technik werden das Elektroautos sein.
Ein Elektroauto fährt klimaneutral, wenn der Strom zum Laden der Batterien ohne CO2-Emissionen erzeugt wird. Diese Anforderung erfüllt Ökostrom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, und bedingt auch aus Biomasse.
Die Stromerzeugung in Deutschland ist auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2023 ein großen Schritt vorangekommen. Vergangenes Jahr betrug der Ökostromanteil laut Bundesnetzagentur 56 Prozent. Damit wurde erstmals mehr als die Hälfte des Stroms durch erneuerbare Energien erzeugt. Im Jahr davor waren es noch 47,4 Prozent gewesen.
Der Stromverbrauch in Deutschland stammte 2023 zu 55 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen. Die etwas geringere Quote als bei der Stromerzeugung entstand hauptsächlich infolge des Stromaustauschs mit unseren Nachbarländern.
Dass erneuerbare Energien einmal über 50 Prozent des Strombedarfs decken könnten, galt noch bis in die 1990er-Jahre in der Bundesregierung und Elektrizitätswirtschaft als völlig illusorisch. Das damals Undenkbare ist heute Realität, was wiederum zuversichtlich macht, dass in ein bis zwei Jahrzehnten 100 Prozent unseres Stroms mit erneuerbaren Energien erzeugt werden.
Dazu müssen Windkraft und Fotovoltaik weiter intensiv ausgebaut werden. Im Jahr 2030 sollen so mindestens 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Und spätestens 2045 soll die Stromerzeugung dann vollständig klimaneutral erfolgen.
Wie wird ein Haus klimaneutral?
Ähnlich wie der Individualverkehr kann auch der Gebäudebereich klimaneutral werden.
Das Schlagwort dazu lautet Dekarbonisierung. Es bedeutet den allmählichen Verzicht auf kohlenstoffhaltige Energieträger zum Heizen. Konkret müssen in den nächsten 20 Jahren alle heute vorhandenen Öl- und Gasheizungen durch kohlenstofffreie Heizungen ersetzt werden.
In einem ersten Schritt müssen seit Anfang dieses Jahres Neubauten in ausgewiesenen Neubaugebieten beim Heizen mindestens 65 Prozent klimafreundliche, erneuerbare Energien nutzen.
Für Bestandsbauten gilt die 65-Prozent-Regel beim Einbau einer neuen Heizung spätestens ab Mitte 2026 (in Städten über 100 000 Einwohnern) bzw. ab Mitte 2028 (in Kommunen unter 100 000 Einwohnern). Bis dahin müssen kommunale Wärmepläne vorliegen, aus denen hervorgeht, ob für ein Gebäude als Ersatz für eine fossile Heizung eine Fernwärme-, Wasserstoff- oder Biogasversorgung geplant ist.
Die wichtigste gesetzliche Grundlage dazu ist die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Das neue GEG – auch als Heizungsgesetz bezeichnet – ist seit dem 1. Januar 2024 in Kraft.
Sämtliche Öl- oder Gasheizungen haben seitdem ein Ablaufdatum, das allerdings weit in die Zukunft reicht. Altkessel mit Niedertemperatur- oder Brennwerttechnik dürfen so lange weiter betrieben werden, bis sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. Endgültig Schluss mit fossil betriebenen Heizungen ist erst am 31. Dezember 2044.
Wer jetzt noch schnell seinen in die Jahre gekommenen Öl- oder Gas-Heizkessel gegen einen neuen austauscht, entscheidet sich nicht nur für ein Auslaufmodell, sondern geht auch ein Risiko ein, was die künftigen Betriebskosten betrifft.
Denn Öl und Gas zum Heizen sollen ab 2027 in den europäischen CO2-Emissionshandel einbezogen werden. Dadurch werden sich diese Heizbrennstoffe über die ab 2026 geltende CO2-Abgabe in Höhe von voraussichtlich 65 Euro pro Tonne in den Jahren danach weiter spürbar verteuern.
Doch wie hoch ist eigentlich der CO2-Ausstoß von älteren Eigenheimen mit einer Öl- oder Gasheizung?
Ein Ölheizkessel bläst pro Jahr bei einem Verbrauch von 2 000 Litern Heizöl rund sechs Tonnen CO2 in die Luft. Dem entsprechen bei einem Erdgas-Heizkessel etwa 20 000 Kilowattstunden Wärmeenergie und fünf bis sechs Tonnen CO2-Emissionen (abhängig vom Flüssigerdgas-Anteil, dessen CO2-Emissionen höher sind als bei Pipeline-Erdgas).
Wie lassen sich Erdöl und Erdgas ausmustern und so die damit beheizten Häuser dekarbonisieren?
Die meisten Energiefachleute und alle großen Heizungshersteller räumen der direkt strombasierten Heizungstechnik den Vorrang vor allen anderen „grünen“ Heiztechniken ein. Ihr klarer Favorit für die klimaneutrale Hausheizung der Zukunft ist die Wärmepumpe. Zum Heizen ist die Wärmepumpentechnik seit Jahrzehnten im Einsatz und technisch ausgereift.
Im Prinzip wie ein Elektroauto wird ein „Elektrohaus“ klimaneutral, wenn der benötigte Strom für die Wärmepumpe und alle übrigen Elektrogeräte im Haushalt ohne Treibhausgase erzeugt wird.
Was ist wichtig für die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen?
Das Heizen mit Wärmepumpentechnik ist hinsichtlich ihrer künftigen Klimaneutralität schlüssig. Hinsichtlich ihrer Effizienz hat die Heiztechnik allerdings einen Haken: Wärmepumpen sind nur dann ausgesprochen energieeffizient, wenn die Maximaltemperaturen im Heizungskreislauf gering ausfallen. Ideal für die Energieeffizienz sind Vorlauftemperaturen von unter 40 Grad Celsius.
Bei solch niedrigen Vorlauftemperaturen erzeugen Wärmepumpen im Jahresdurchschnitt aus einer Kilowattstunde elektrischer Energie drei bis vier Kilowattstunden Wärmeenergie. Den jährlichen Heizwärmeertrag im Verhältnis zum dafür eingesetzten Strom bezeichnet man als Jahresarbeitszahl (JAZ). Je höher sie ist, desto niedriger fallen die Stromkosten der Wärmepumpe aus.
Die Jahresarbeitszahl ist die entscheidende Kennziffer für die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe. Zwar gibt es für Wärmepumpenstrom bei jedem Energieversorger einen im Vergleich zu Haushaltsstrom verbilligten Tarif. Der aber liegt pro Kilowattstunde stets deutlich höher als dies bei Heizöl und Erdgas der Fall ist.
Das hat sich nach dem krisenbedingten Auf und Ab der Preise für Öl und Gas im vergangenen Jahr nicht geändert. So wie vor der Energiekrise kostet Wärmepumpenstrom pro Kilowattstunde wieder ungefähr das Dreifache wie bei Heizöl und Erdgas.
Wer derzeit eine Wärmepumpenheizung in Betrieb nimmt, zahlt für die Kilowattstunde Wärmepumpenstrom je nach Anbieter 25 bis 30 Cent. Bei Erdgas liegt der Wärmepreis pro Kilowattstunde für Neukunden bei sieben bis acht Cent, Heizöl kostet umgerechnet auf die Kilowattstunde Wärmeenergie zehn bis elf Cent.
Was bringt thermisches Sanieren für den Wärmepumpenbetrieb?
Altbauten, die vor der Anfang 1995 in Kraft getretenen Dritten Wärmeschutzverordnung entstanden, sind verglichen mit modernen Neubauten meist ausgesprochene Energieschlucker. Gebäude mit Baujahr vor 1995 machen rund 70 Prozent des gesamten Altbaubestandes aus.
Um diese Gebäude auch an kalten Wintertagen angenehm warm zu halten, läuft die Gas- oder Ölheizung mit Heizwassertemperaturen von 60 Grad Celsius und mehr. Für Gas- und Ölheizkessel ist das kein Problem. Für Standard-Wärmepumpen schon; sie sind für solch hohe Vorlauftemperaturen nicht ausgelegt.
Nur sogenannte Hochtemperatur-Wärmepumpen erreichen Vorlauftemperaturen über 60 Grad Celsius; der Stromverbrauch nimmt dabei aber deutlich zu, die Wirtschaftlichkeit der Wärmeerzeugung entsprechend ab.
Jeder Energieschlucker-Altbau mit einer Öl- oder Gasheizung lässt sich aber an eine Wärmepumpe anpassen, ohne dass anschließend die Stromkosten ins Uferlose steigen.
Der Schlüssel für die Anpassung eines ungedämmten Energieschlucker-Altbaus an eine Wärmepumpenheizung ist eine „Energiediät“ in Form einer thermischen Sanierung. Die umfasst in der Regel die Wärmedämmung der Außenwände, des Daches und der Kellerdecke, sowie meist auch den Austausch der alten Isolierglasfenster gegen hochdämmende Dreischeibenfenster.
Optimal ist eine thermische Sanierung, wenn es gelingt, den Heizwärmebedarf auf den Standard heutiger Neubauten zu senken. Damit schafft man einen soliden Grundstein für eine hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe.
Geradezu ideale Voraussetzungen für eine Wärmepumpe bestehen, wenn in einem thermisch sanierten Altbau auch noch eine Flächenheizung – meist ist das eine Fußbodenheizung – vorhanden ist.
In Vergangenheit mittelmäßig gedämmte Altbauten bergen bei der Umrüstung auf eine Wärmepumpenheizung finanzielle Risiken. Das betrifft weniger die Investitionskosten als vielmehr die späteren Betriebskosten.
Eine 2020 veröffentlichte Untersuchung des Fraunhofer-Instituts zur Effizienz von Wärmepumpen in insgesamt 56 thermisch teilsanierten Bestandsgebäuden offenbarte erhebliche Unterschiede bei den Jahresarbeitszahlen.
In den Altbauten mit einer Außenluft-Wärmepumpe lagen die Jahresarbeitszahlen zwischen 2,5 bis 3,8. Die untersuchten Erdreich-Wärmepumpen erreichten Zahlen zwischen 3,3 und 4,7. Diese Schwankungsbreiten zeigen, wie schwer die Effizienz von Wärmepumpen in thermisch teilsanierten Altbauten einzuschätzen ist.
Eigentümer*innen solcher Häuser, die den Wechsel auf eine Wärmepumpe erwägen, sollten deshalb zuerst eine mit dieser Heiztechnik vertraute und unabhängige Gebäudeenergieberater*in um Rat fragen. Wer auf die anfängliche Eignungsprüfung verzichtet, riskiert, später von unerwartet hohen Betriebskosten überrascht zu werden.
Zusammengefasst gilt für den Einbau einer Wärmepumpe in Altbauten die Faustregel: Je besser es gelingt, den Energiebedarf des Hauses durch Wärmedämmung nach unten zu drücken, desto günstiger sind die Voraussetzungen für eine hohe Jahresarbeitszahl – sprich Effizienz – der Wärmepumpe und damit für einen geringen Verbrauch von Wärmepumpenstrom.
Wenn nach der Sanierung zusätzlich Sonnenwärme genutzt wird, dann reduzieren sich die Heiz- und Warmwasserkosten sogar noch einmal. Denn auch für das Anzapfen der Sonne gilt: Je geringer der Wärmebedarf, desto mehr Ertrag bringt eine solare Heizungsunterstützung im Frühjahr und im Herbst.
Grundsätzlich ist ein sehr geringer Wärmebedarf auch die beste Voraussetzung, um zukünftige Innovationen in der Heiztechnik wie etwa CO2-frei erzeugten, „grünen“ Wasserstoff für eine Brennstoffzellenheizung zu nutzen. Kostengünstiger als Ökostrom in Verbindung mit einer Wärmepumpe dürften Energieinnovationen aber wohl kaum ausfallen.
Ob Wärmepumpe, solares Heizen oder innovative klimaneutrale Heiztechniken – eine universelle Strategie und ein umfassendes Leitbild für klimaneutrales Sanieren liefert die Energiesparpyramide.
Was ist die Grundidee der Energiesparpyramide?
Wer sich gesund und ausgewogen ernähren will, der erhält mit der Lebensmittelpyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ein einfaches Leitbild. Nach diesem Muster funktioniert die Energiesparpyramide. Sie bietet Hauseigentümern und Hauseigentümerinnen, die ihren Altbau in Richtung Klimaneutralität modernisieren wollen, ein fundamentales und leicht verständliches Leitbild.
Die Pyramide gehört zu den ältesten Architekturformen der Menschheitsgeschichte. Pyramidenbauwerke entstanden unabhängig voneinander in vielen Hochkulturen, seit die ersten Menschen vor mehr als 10 000 Jahren begannen sesshaft zu werden und in Städten zu leben.
Ihr Symbol in der Energiesparpyramide steht für Ganzheitlichkeit, Stabilität und Zeitlosigkeit. Die elf Pyramidenbausteine sind ein Sinnbild für Einfachheit, Systematik und Prioritäten.
Gerade letztere Eigenschaften sind wertvoll angesichts der grenzenlosen Flut an Energiesparinformationen, mit denen uns das Internet überschwemmt, und was in vielen Fällen die Überlegungen von Hauseigentümer*innen eher erschwert als erleichtert.
Warum ist eine gedämmte Gebäudehülle am wichtigsten?
Der Grundsatz der Energiesparpyramide lautet: Energieeffizienz ist gut, Energieeinsparung ist besser. Energieeinsparung geht vor Energieeffizienz, weil nicht benötigte Energie auch keine Treibhausgase verursacht.
Nachträgliche Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch bei fast jedem Altbau am stärksten und bildet deshalb die Basis der Energiesparpyramide. Durch besseren Wärmeschutz die Ursachen für übermäßiges Heizen zu kurieren ist vernünftiger als mit effizienter Heiztechnik an den Symptomen herumzudoktern.
Diese klare Strategie spart am Ende am meisten CO2, noch mehr dann, wenn zusätzlich für die Wärmedämmung Dämmstoffe auf der Basis von Holz verwendet werden. Das beim Wachstum von Holz der Atmosphäre entzogene CO2 wird im Holzdämmstoff langfristig gespeichert.
Weitere Argumente für den Vorrang des Dämmens liefern der Kostenaspekt und die Langlebigkeit: Eingesparte Energie verursacht nach einer einmaligen Investition keine Folgekosten und Wärmedämmung hält jahrzehntelang.
Energiesparen bedeutet hier auch keinen Verzicht, sondern genau das Gegenteil: einen Gewinn an Wohnkomfort. In schlecht gedämmten Altbauten ist es im Winter kühl und ungemütlich, in gut gedämmten dagegen warm und behaglich.
Wie ist die Energiesparpyramide aufgebaut?
Eine rundum gut gedämmte Gebäudehülle ist die Basis der Energiesparpyramide. Darauf aufbauen tun CO2-arme Wärmetechnik – gegenwärtig am besten durch eine Wärmepumpe – sowie die klimaneutrale Wärmeerzeugung durch eine thermische Solaranlage.
Ein „Anti-Reboundeffekt-Baustein“, der die achtsame Energienutzung nach Einsparmaßnahmen betont, schließt den Bausteinblock Wärmetechnik ab.
Die Energiesparpyramide räumt dem Einsparen von Wärme Vorrang vor dem Stromsparen im Haushalt ein. Das hat seinen Grund.
In unsanierten Altbauten werden meist 80 bis 90 Prozent des gesamten Energieverbrauchs für Heizung und Warmwasser aufgewendet. Und selbst nach einer energetischen Grundsanierung ist der Energieverbrauch für die Heizung – selbst wenn eine Wärmepumpe läuft – meist immer noch höher als der Stromverbrauch im Haushalt.
Hinzu kommt, dass Strom aus dem Netz zunehmend aus erneuerbaren Energiequellen stammt und Stromeinsparungen so eine geringere CO2-Reduktion bewirken als eingesparte Treibhausgase aus einer Öl- oder Gasheizung.
Der Unterschied bei den CO2-Emissionen zwischen fossil erzeugter Wärmeenergie und Netzstrom wird in den nächsten Jahren durch den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeuger, insbesonders der Windkraft, weiter zunehmen.
Je weniger CO2-Emissionen künftig bei der Erzeugung von Netzstrom anfallen, desto geringer wird auch die Bedeutung einer Fotovoltaikanlage für die Klimaneutralität eines Hauses. Daran ändert selbst eine Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher wenig, denn die Sonne lässt sich im Winter einfach zu selten blicken.
Solarzellen erzeugen zwar CO2-freien Strom, aber von Anfang November bis Ende Februar haben die meiste Zeit über ihre natürlichen „Feinde“ die Oberhand: Schneefälle, Regenwolken, Dunst und Nebel. Obendrein drosseln kurze Tage und lange Nächte die solare Stromerzeugung.
Eine Fotovoltaikanlage liefert in den Monaten November, Dezember, Januar und Februar im langjährigen Mittel insgesamt nur 12 bis 13 Prozent der Strommenge, die sie das gesamte Jahr über produziert. Von November bis Februar ist der Stromverbrauch im Haus aber am höchsten – besonders dann, wenn mit einer Wärmepumpe geheizt wird.
Fazit: Das öffentlichen Netz bleibt im Winter unersetzbar als Hauptlieferant von klimafreundlichem Strom – meist vor allem aus Windkraftanlagen -, aber auch noch lange von klimaschädlichem Strom aus Kohle und Gas.
Je weniger Strom ein Haus mit Wärmepumpe im Winter benötigt, desto mehr hilft das dem Klimaschutz. Der CO2-freien Stromerzeugung mit einer Fotovoltaikanlage gebührt daher nur die Rolle des Sahnehäubchens auf der Spitze der Energiesparpyramide.
Warum ist die Energiesparpyramide kein Sanierungskonzept?
Die Energiesparpyramide verkörpert ein fundamentales und universelles Leitbild für klimaneutrales Sanieren. Sie hat aber auch ihre Grenzen.
Denn viele Altbauten weisen zum Beispiel erhaltenswerte Baudetails auf – wie etwa historischen Fassadenschmuck oder Sichtfachwerk. Auch sind ältere Häuser heute überwiegend energetisch teilsaniert, der erreichte Energiestandard ist aber meistens nicht zeitgemäß. Und wohl immer wollen ihre Eigentümer*innen bei einer energetischen Sanierung auch die Wohnqualität und den Wert des Hauses steigern.
Solche Aspekte mit hoher Energieeinsparung und CO2-Reduktion zu verbinden, verlangt Fachkenntnisse. Wer ein älteres Haus klimagerecht sanieren will, sollte deshalb die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit 80 Prozent der Kosten geförderte „Energieberatung für Wohngebäude“ oder eine qualitativ vergleichbare Fachberatung in Anspruch nehmen.
Dabei erstellt eine zertifizierte Gebäudeenergieberater*in ein individuelles Sanierungskonzept. Dabei kann die Energiesparpyramide ein roter Faden zum besseren Verständnis des Konzepts für Laien sein.
Außerdem verringert sich das Risiko eines untauglichen Sanierungskonzepts, weil der Hausbesitzer bzw. die Altbaueigentümerin die vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen mithilfe der Energiesparpyramide einordnen und so besser hinterfragen kann.
Weshalb bleibt Energiesparen auch in Zukunft ein Dauerthema?
Der Winter 2023/2024 war hierzulande der drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Der Februar und März 2024 waren sogar die wärmsten dieser Monate seit Messbeginn.
Kein Wunder also, dass zu Frühlingsanfang die großen Erdgasspeicher in Deutschland noch zu etwa zwei Dritteln gefüllt waren.
Am Ende des weitgehend frostfreien Winters verkündete die Bundesnetzagentur daher auch das Ende der Energiekrise. Die war zwei Jahre zuvor nach dem Wegfall der Erdgaslieferungen aus Russland ausgerufen worden.
Wenn es aber – was wahrscheinlich ist – in Mittel- und Nordeuropa wieder einmal einen sehr kalten Winter gibt, könnte es leicht erneut zu einer Energiekrise kommen. Denn während einer wochenlangen Kälteperiode gepaart mit einer „Dunkelflaute“ bei Sonne und Wind müssten nicht nur die Kohle-, sondern auch die Erdgaskraftwerke hierzulande mit voller Kraft Strom erzeugen.
Bei kaltem Winterwetter steigt zudem fast überall der Stromverbrauch. Und auch die Gasheizungen in den Haushalten liefen dann auf Hochtouren.
Die Erdgasspeicher würden sich bei lang anhaltender Kälte mehr und mehr leeren. Zudem wäre in unseren Nachbarländern an sehr kalten Wintertagen der Strom knapp, was die Möglichkeit von Stromimporten zum Ausgleich einer Dunkelflaute bei der Stromerzeugung einschränken würde.
Energiesparen bleibt daher noch lange ein wichtiger Baustein für Energiesicherheit, insbesondere im Winter.
Hohe Energieeinsparungen, ebenso insbesondere im Winter, lassen sich bei Altbauten durch energetisches Sanieren erzielen. Mit welchen Bausteinen das umfassend gelingt, zeigt die Energiesparpyramide. Leicht verständlich und auf einen Blick.
Links
- Bundesweite Kampagne „Energiewechsel“ mit Informationen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG): Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Berlin
- Studie „Wärmeschutz und Wärmepumpe – warum beides zusammengehört“: Institut für Energie und Umweltforschung (ifeu), Heidelberg
- Wärmepumpen als Schlüsselelement der klimagerechten Gebäudesanierung: Stiftung Denkfabrik Klimaneutralität, Berlin
- Felduntersuchung zur Effizienz von Wärmepumpen in Altbauten: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg i. B.
- Informationen zum Thema Wärmepumpen in Bestandsgebäuden: Bund der Energieverbraucher e. V., Unkel
- Bundesförderung der Energieberatung für Wohngebäude: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Eschborn
Ein älteres Haus klimaneutral zu machen, ist rein energetisch nicht so schwierig. Die Energiesparpyramide liefert dazu ein universelles und schlüssiges Leitbild. Es zeigt, wie vorteilhaft es ist, zuallererst den Energieverbrauch zu minimieren.
Bitte Foto klicken
Alle Rechte vorbehalten.
Copyright 2015-2024 Expo Stadt, Hartmut Schulz
Idee, Manuskript und grafische Form der Energiesparpyramide ist geistiges Eigentum von Hartmut Schulz und nach dem geltenden Urheberrechtsgesetz geschützt. Insbesondere darf das Manuskript zur Energiesparpyramide nicht ganz oder teilweise oder in Auszügen abgeschrieben oder in sonstiger Weise vervielfältigt werden. Jegliche Verwendung der Energiesparpyramide in textlicher, bildlicher und grafischer Form bedarf der Genehmigung von Expo Stadt, Lange Straße 77, 34131 Kassel